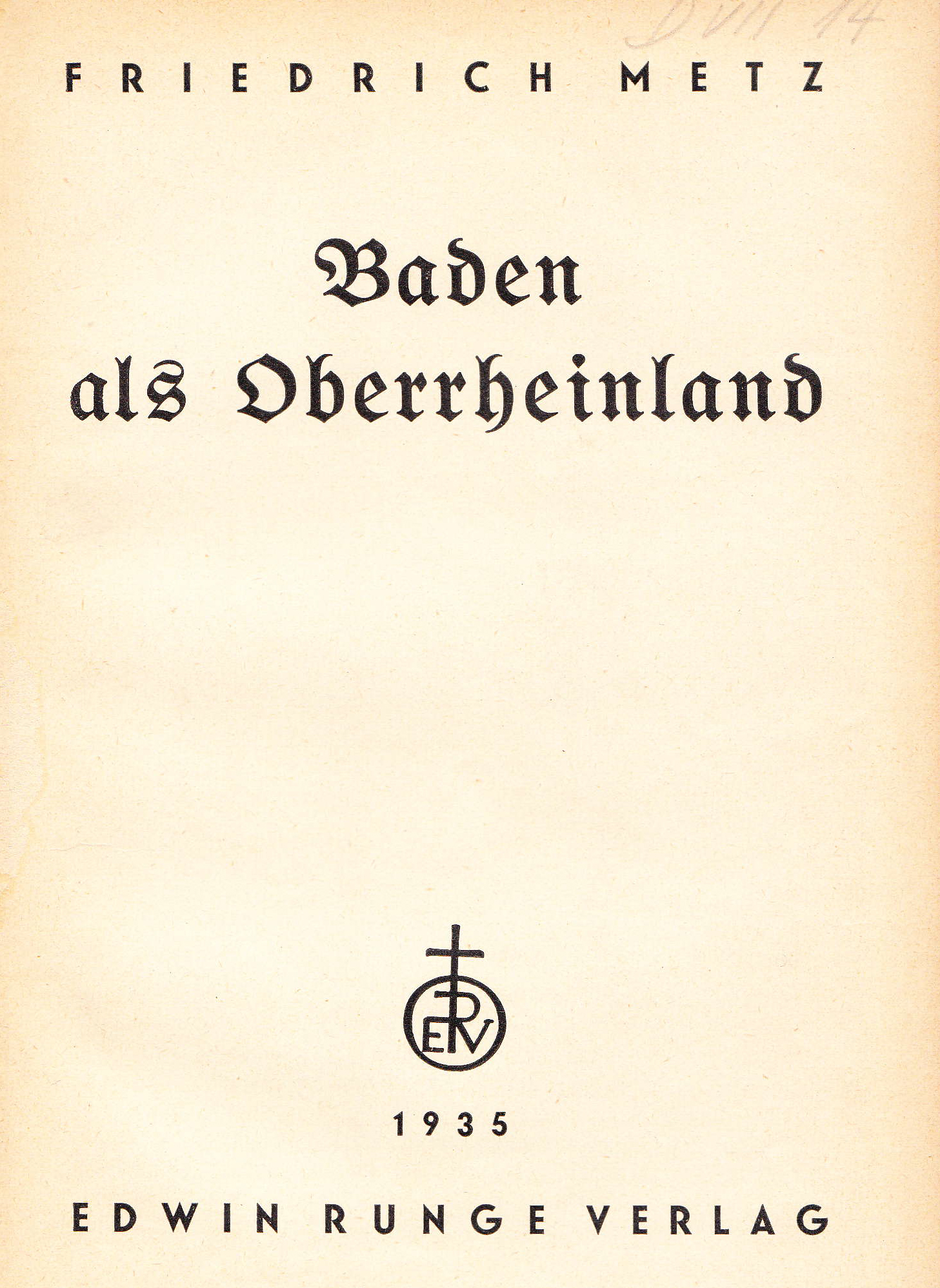Warum Baden und Württemberg nicht vereinigt werden dürfen – eine Denkschrift aus dem badischen Staatsministerium von 1935
Die badische Ministerialbürokratie kämpfte seit 1933 an mehreren Fronten, um die eigene Marginalisierung abzuwehren: Zum einen drohten den Landesministerien erhebliche Kompetenzverluste, da die Reichsministerien neue Aufgaben an sich zogen, zum anderen musste man sich der Ambitionen der NSDAP-Parteibürokratie erwehren, die auf vielen Feldern in die Belange der Staatsverwaltung eingriff, und über allem schließlich schwebte die latente Gefahr einer „Reichsreform“, die die Existenz der badischen Landesverwaltung überhaupt in Frage stellte. Konkreten Anlass zur Sorge gaben eine Rede Reichskanzler Adolf Hitlers auf dem Reichsparteitag der NSDAP im September 1933, in der er die Länder als Relikte einer vergangenen Zeit bezeichnete und ihre Beseitigung ankündigte, und stärker noch das Gesetz über den Neuaufbau des Reiches vom 30. Januar 1934, das die Hoheitsrechte der Länder formal auf das Reich übertrug. Da es sich hierbei um ein reines Rahmengesetz handelte, blieb die Neugestaltung des Verhältnisses von Reichs- und Mittelinstanzen ebenso offen wie die territorial-administrative Neugliederung des Reiches. Lösungen für diese Probleme zu finden, fühlten sich verschiedene Stellen berufen: federführend Reichsinnenminister Wilhelm Frick, aber auch ein Stab, der beim Stellvertreter des Führers Rudolf Heß gebildet wurde.
Die Befürchtung, dass die Reichsreformdebatten für Baden unangenehme Konsequenzen haben könnten, wird in den Akten der Karlsruher Landesministerien im Protokoll einer Sitzung des Staatsministeriums vom 17. November 1933 offenkundig: Vor Eintritt in die Tagesordnung schlug Ministerpräsident Walter Köhler dem Reichsstatthalter Robert Wagner und seinen drei Ministerkollegen „in vertraulicher Besprechung vor, eine Denkschrift über die badischen Interessen beschleunigt ausarbeiten zu lassen, die bei einer Reichsvereinheitlichung zu wahren sind, und weiter über die Gefahren, denen das badische Volk und seine Wirtschaft ausgesetzt sein können, wenn diese Vereinheitlichung nicht in einer den Interessen Badens entsprechenden Weise durchgeführt werden sollte“. Diesem Vorschlag stimmten die Anwesenden zu: Die einzelnen Ministerien sollten Material für eine solche Denkschrift zusammentragen und „ihre Ausarbeitungen der Staatskanzlei zur weiteren Veranlassung übermitteln“.
Die Ausarbeitungen aus den Ministerien (Inneres, Finanzen und Wirtschaft, Justiz, Kultus) trafen weisungsgemäß binnen kurzer Zeit ein, und im Dezember 1933 wurden sie in der Staatskanzlei zu einer ersten Denkschrift zusammengefasst, die in ihrer Ausrichtung deutlich unter dem Eindruck der öffentlichen Debatten stand, die in diesen Wochen über die Reichsreform eingesetzt hatten. Anfang Dezember war in der badischen Presse zum Beispiel über die Pläne des Magdeburger Regierungspräsidenten Helmut Nicolai berichtet worden, der die Zerschlagung der Länder und die Neueinrichtung von 13 Gauen an ihrer Stelle vorgeschlagen hatte; Nicolai zufolge war Baden dabei aufzuteilen: Südbaden sollte dem Gau „Schwaben“ zugeschlagen werden und Nordbaden mit Nordwürttemberg, dem Saarland und der Rheinpfalz den Gau „Rheinfranken“ bilden. Diesen Vorschlag wies die Denkschrift als gänzlich abwegig zurück und erteilte auch dem Plan eines Zusammenschlusses Badens mit Württemberg eine Absage. Dabei wurden wirtschaftliche Argumente ebenso vorgebracht wie geopolitische: Baden müsse als „Grenzmark“ erhalten bleiben.
Ob die Denkschrift vom Dezember 1933 außerhalb der Landesregierungskreise in Umlauf gebracht wurde oder ob man sie als argumentatives Instrument für einen akuten Notfall in der Reserve hielt, erschließt sich aus den badischen Akten nicht. Zunächst einmal abzuwarten, war jedenfalls insofern eine taugliche Strategie, als die Reichsreformdebatten in den nächsten Monaten so verschlungene Pfade nahmen, dass Hitler schließlich persönlich ein Verbot aussprach, das Thema überhaupt noch in der Öffentlichkeit zu erörtern. Für die badischen Belange wichtiger noch als die wachsenden Zweifel an der Realisierbarkeit der Neugliederungspläne war, dass sich ihre Prämissen zwischenzeitlich änderten: Von den von Nicolai ins Spiel gebrachten 13 Gauen rückte man allmählich zugunsten einer größeren Zahl ab. Bei einer Neuaufteilung des Reiches in 20 Gaue aber wäre die Gefahr einer Aufteilung Badens nicht mehr zwangsläufig gegeben gewesen. Im Gegenteil konnte die Reichsreform in einer solchen Variante für Baden sogar als attraktiv erscheinen, denn als einer der kleineren der 20 Gaue vermochte er vielleicht sogar den Anspruch auf Zuwachs erheben. Auch darauf bereiteten sich die Karlsruher Ministerien argumentativ vor: Eine zweite Reichsreformdenkschrift von Ende Januar 1935 – zufällig oder absichtlich datiert auf den zweiten Jahrestag der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler – spielte die territoriale Arrondierung Badens schon einmal durch und erklärte einen Zugewinn von knapp 280.000 Hektar Fläche mit mehr als 300.000 Einwohnern für wünschenswert. Abgeben sollten diese in absteigender Größe der Territorien: Württemberg, Hessen, Hohenzollern und Bayern.

Verzeichnis über die abgegebenen Exemplare der Denkschrift vom 19.3.1935 (aus: GLA 233 25715) | Klicken zum Vergrößern
Die Beschäftigung mit dem Thema entfaltete dann in der Karlsruher Staatskanzlei offenkundig eine Eigendynamik, denn nochmals zwei Monate später legte deren Leiter, Ministerialrat Friedrich Karl Müller-Trefzer, noch ein drittes Memorandum vor, in dem die defensiven Argumente aus der ersten Denkschrift mit den offensiven aus der zweiten verknüpft wurden. Aus den komplexen Gedankengängen dieser Denkschrift seien an dieser Stelle nur einige Argumente gegen einen Zusammenschluss Badens und Württembergs mitgeteilt, den Müller-Trefzer nachdrücklich ablehnte: Das durch eine „solche Vereinigung erwachsende Gaugebilde würde mit seiner Gesamteinwohnerzahl so stark über das für den einzelnen Gau durchschnittlich anzunehmende Maß hinausgehen, daß es sich nur sehr unorganisch in den Reichsaufbau einfügen würde“. Generell konstatierte Müller-Trefzer für die beiden Länder gravierende Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur und im „Volkscharakter“; vor allem aber würde ein Zusammenschluss Baden seinen so wichtigen „Grenzmarkcharakter“ rauben: „Bei einem Zusammenwerfen der beiden Länder würde der Schwerpunkt der Verwaltung zwangsläufig weit in das Innere, nach Stuttgart, verlegt werden“. Die Folge wäre ein „Niedergang“ Karlsruhes und eine „weitere Schädigung“ Mannheims und insgesamt eine unbedingte „Provinzialisierung in der schlimmsten Bedeutung dieses Wortes für das badische Gebiet“. Die „schädigende Wirkung“ würde sich am stärksten in jenem Teil des Landes zeigen, „der zwischen Schwarzwaldkamm und Rheinstrom liegt“.
Eine Schwächung Süd- und Mittelbadens wäre in gesamtdeutscher Perspektive verhängnisvoll. „Im Gegenteil, gerade Frankreich, dem stammesgleichen Elsaß gegenüber, wie übrigens auch gegenüber der deutschen Schweiz, kommt es darauf an, die angrenzenden Gebiete nicht veröden zu lassen, sondern sie im Gegenteil mit möglichst stark pulsierendem Eigenleben zu erfüllen, um von dort aus der Werbung des Auslandes zu begegnen und andererseits dem Deutschtum jenseits der Grenzen die unbedingt nötige Stütze bieten zu können“, meinte Müller-Trefzer und zitierte anschließend, um die grundsätzliche weltanschauliche Bedeutung der Angelegenheit zu unterstreichen, aus einem Schreiben des badischen Kultusministers Otto Wacker an das Reichserziehungsministerium vom Vormonat, in dem dieser die besondere Aufgabe der badischen Universitäten als Grenzlandhochschulen hervorgehoben hatte: „Der Kampf gegen den westischen Liberalismus und sein stärker gewordenes Kind, den jüdisch-westischen Marxismus, wird vor allem an der Stelle geführt werden müssen, wo rein räumlich die Anschauungen unmittelbar zusammenprallen“. Ein solcher Kampf, so führte Müller-Trefzer Wackers Gedanken weiter, könne aber „nur dann mit Aussicht auf Erfolg geführt werden, wenn eine unter gleichen Bedingungen und Gefahren wie die Bevölkerung selbst lebende Gauverwaltung an Ort und Stelle bleibt“ – und nicht nach Stuttgart umzieht, musste hier nicht noch expliziert werden. „Nur eine solche würde in der Lage sein, die im Frieden und – was noch wichtiger sein würde – im Falle kriegerischer Verwickelungen, mit deren Möglichkeit wie die Heeresverwaltung eine vorsorgliche Zivilverwaltung stets rechnen muß, im Interesse des Reichsganzen wie der Grenzbevölkerung selbst notwendige maximale Wirkung zu entfalten“.
Anders als für die ersten beiden Denkschriften sind für die dritte einige Informationen über ihre Verbreitung überliefert: Sie wurde in 50 Exemplaren ausgefertigt, von denen etwas mehr als die Hälfte auch in Umlauf gelangte. Der Reichsstatthalter erhielt zwei Exemplare, die badischen Landesminister und verschiedene hohe Beamte der Ministerialbürokratie je eines, und auch die Leiter des Oberlandesgerichts und des Rechnungshofs in Karlsruhe wurden bedacht. Außer Landes gelangten offenkundig nur zwei Exemplare: Eines erhielt Reichsinnenminister Frick, das andere der Erlanger Geographieprofessor Friedrich Metz, den Müller-Trefzer dazu veranlasst hatte, den badischen Selbstbehauptungsbemühungen im Sinne der drei Denkschriften mit einer Broschüre für die Öffentlichkeit zu sekundieren – diese erschien ebenfalls 1935 unter dem Titel „Baden als Oberrheinland“ in einem Berliner Verlag. Ob die Denkschrift, die also im Wesentlichen nur an diejenigen Personen verteilt wurde, die mit ihrer Entstehung befasst gewesen waren, über die Aktenablage hinaus noch irgendwelche Wirkungen entfaltete, ist dem Verfasser dieser Zeilen bislang nicht bekannt, insbesondere auch nicht, ob die badischen Gegner der Südweststaatsgründung, in deren Kreisen die Denkschrift bekannt gewesen sein könnte, in den Jahren von 1948 bis 1951 vielleicht auf das von Müller-Trefzer gesammelte Material zurückgegriffen haben. Müller-Trefzer selbst erwähnte die Denkschriften in seinen im Jahr der Gründung Baden-Württembergs niedergeschriebenen Lebenserinnerungen, die sonst recht breit über seine amtliche Tätigkeit im „Dritten Reich“ berichten, im Übrigen nicht. Ob er es gerade zu diesem Zeitpunkt für unangebracht hielt, sich selbst als ehemaliger wortstarker Agitator badischer Selbständigkeit zu bekennen, oder ob er die Diskussionen wegen ihrer Folgenlosigkeit rückschauend für unwichtig erachtete, steht dahin.
Literatur und Quellen:
Walter Baum, Die „Reichsreform“ im Dritten Reich, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 3 (1955), S. 36-56.
GLA 233 24318, 25714, 25715, 27906
Quellenanhang:
GLA 240 Zugang 1987-53 403